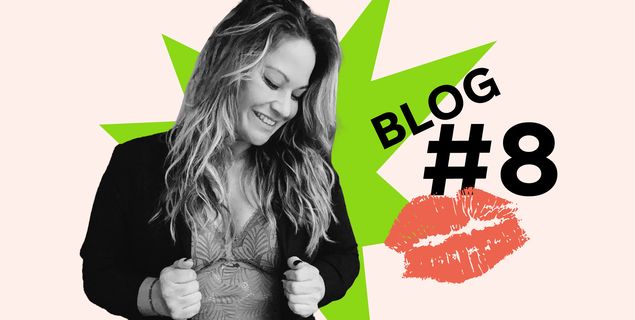Ich erinnere mich noch genau an den Moment. Dieser Augenblick, in dem der Arzt den Mund öffnete und ich innerlich schon wusste: Das hier wird kein harmloser Befund. Ich hatte gehofft auf etwas, das man mit einer Salbe, einer Pille oder mit einem guten Physiotherapeuten wieder wegkriegt. Oder mit massenhaft Antibiotika. Stattdessen kam da dieses Wort. Dieses neue, fremde, schwere Wort, das sich in meinem Kopf einnistete wie ein unangemeldeter Gast, der beschlossen hat, für immer zu bleiben. Es hörte sich verdammt beschissen an.
Ab da war nichts mehr so wie vorher.
Nicht die Tage, nicht mein Körper, nicht einmal der Blick in den Spiegel. Ich sträubte mich mit viel Wut gegen die neue Realität.
Zuerst kam aber der blöde Schock. Dann die Stille. Diese absurde Stille, in der man innerlich schreit, aber nach aussen hin nickt, als hätte man gerade erfahren, dass es am Freitag wieder regnet. Der Körper fühlt sich plötzlich an, als gehöre er jemand anderem. Das Zittern, das Brennen, die Müdigkeit, die Gelenke, die sich benehmen, als wären sie 90, während der Rest von mir noch 40 ist. Oder 20. Oder einfach nur müde.
Je nach Krankheit geht es unterschiedlich los. Bei manchen fängt es mit Hautausschlägen an, bei anderen mit Schmerzen, die einfach nicht mehr weggehen. Mit einem Ohr, das plötzlich schlechter hört, mit Schwindel, mit Taubheit, mit einer Erschöpfung, die kein Mittagsschlaf der Welt heilt. Oder die Verdauung streikt. Und immer dieses nagende Gefühl: Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Du weisst es.
Man geht von Arzt zu Arzt, erzählt immer wieder dieselbe Geschichte, wie ein schlecht bezahlter Schauspieler auf endloser Tournee und lernt auch das Medical Gaslighting kennen. Auch das schmerzt enorm. «Die Werte sind unauffällig», sagen die einend. «Vielleicht psychisch», murmeln die anderen. Und du beginnst zu zweifeln, an dir, an deinem Körper, an deinem Verstand.
Manchmal bekommt man gar keine Diagnose. Manchmal bekommt man zehn verschiedene. Und wenn dann endlich eine bleibt, fühlt sich das seltsam an: Erleichterung und Verzweiflung im selben Atemzug.
Endlich weiss man, was es ist, und gleichzeitig weiss man, dass man ab jetzt damit leben muss. Tschüss altes Leben, es war schön mit dir.
Die Medikamente kommen, die Nebenwirkungen gleich mit. Viele Termine und Stressgefühle. Man lernt, den Tag in Etappen zu planen, weil die Energie nie reicht für alles. Man wird Experte für Dinge, von denen man vorher keine Ahnung hatte: Entzündungswerte, Cortisonstufen, Autoimmunprozesse. Und man merkt, dass «gesund» nicht mehr der Normalzustand ist, sondern ein ferner Gedanke, den man manchmal abends auf dem Sofa anschaut und denkt: So ist das nun also.
Was viele vergessen: Eine Diagnose verändert nicht nur den Körper, sie verändert das ganze Leben. Beziehungen, Freundschaften, die Art, wie man arbeitet, lacht, liebt. Und dich. Dich.
Man lernt, wer bleibt, wenn’s ernst wird. Und wer lieber verschwindet, weil chronische Krankheiten nicht so gut in den Lebenslauf passen. Man verliert und findet sich wieder.
Ich habe irgendwann aufgehört, auf Verständnis zu warten. Stattdessen habe ich angefangen, es mir selbst zu geben. Ich habe gelernt, Grenzen zu setzen, Pausen zu machen, mir Hilfe zu holen. Und vor allem: nicht jeden Tag stark sein zu müssen. Manchmal verliere ich mich immer noch. Aber selten. Trotzdem dauert dieser Prozess der Akzeptanz ewig und drei Tage.
Denn ja, der Boden wird einem unter den Füssen weggezogen. Aber irgendwann lernt man, auf unebenem Boden zu tanzen.
Was bis dahin etwas hilft:
Zu wissen, dass man nicht allein ist. Sich zu informieren, ohne sich zu verlieren. Sich Menschen zu suchen, die zuhören, statt zu urteilen. Und an den Tagen, an denen nichts mehr geht, sich selbst zu sagen: Ich bleibe trotzdem hier. Es wird wieder besser. Aber es braucht Zeit.