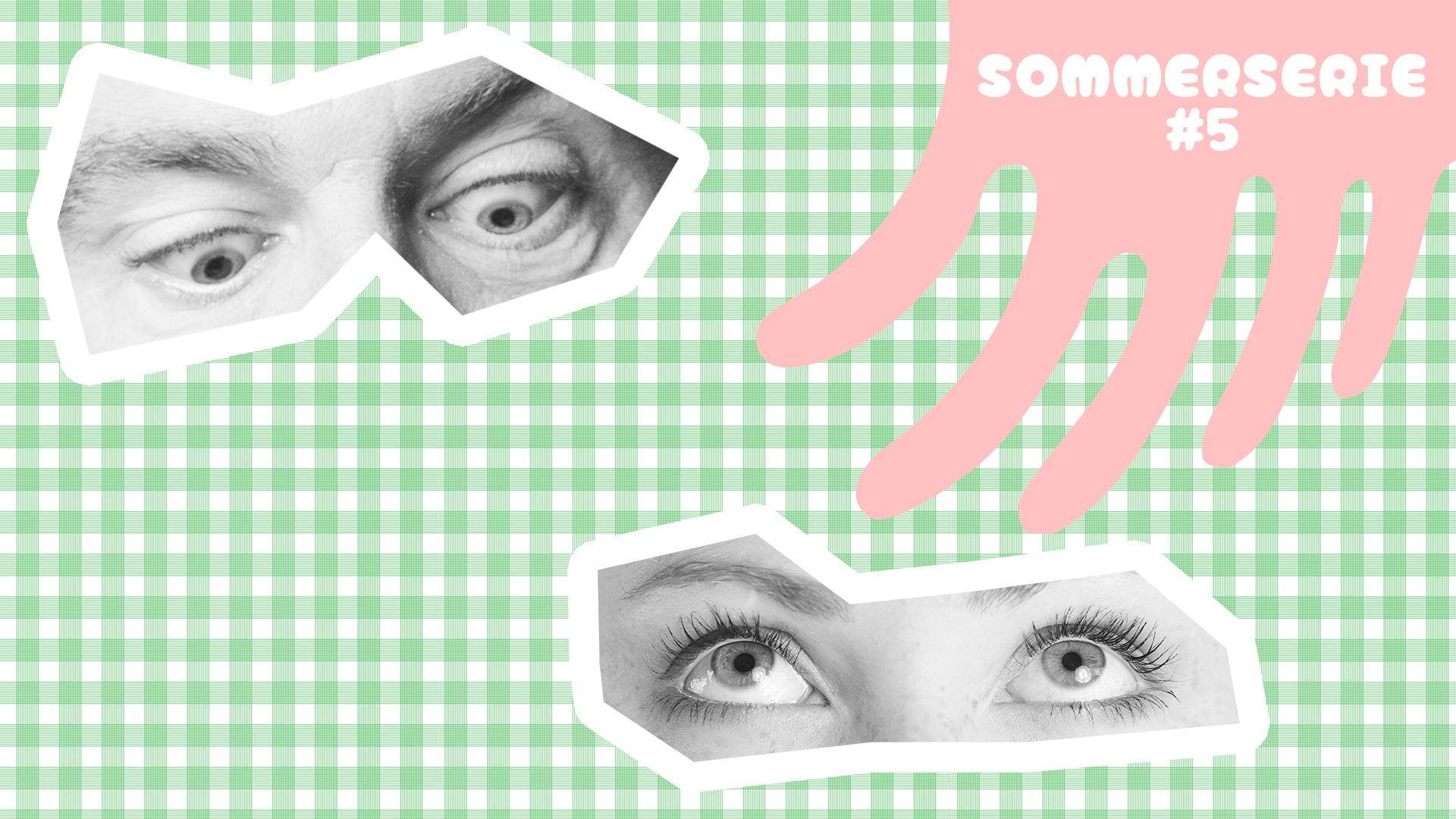
Da liegt der Ursprung
Wer von Kommunikation «auf Augenhöhe» spricht, meint meist: respektvoll, gleichwertig, ohne Hierarchie. Was im Business-Alltag oder in Beziehungen als moderne Haltung gilt, hat seinen Ursprung in der Pädagogik. Mit den reformpädagogischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts – etwa durch Maria Montessori oder Janusz Korczak – wurde das autoritäre Erziehungsmodell zunehmend hinterfragt.
Anstelle der Auffassung, dass Kinder zu gehorchen haben, sah man Kinder neu als eigenständige Persönlichkeiten mit Bedürfnissen und Rechten. Die Devise der Pädagog:innen: Das soll sich auch in der Haltung widerspiegeln. Wer mit einem Kind spricht, soll sich hinknien, Augenkontakt suchen, auf seiner Ebene kommunizieren. So entstand das Bild einer Erziehung «auf Augenhöhe».
Die Redewendung steht deshalb für einen grundlegenden kulturellen Wandel im Umgang mit Macht, Kommunikation und Beziehung – und ist mehr als eine schöne Metapher. So verbreitet die Redewendung auch ist, stellt sich aus inklusiver Perspektive die Frage: Was ist mit Menschen, die körperlich nicht «auf Augenhöhe» kommunizieren können?
«Ich finde diesen Ausdruck nicht negativ – im Gegenteil. Für mich ist ‚auf Augenhöhe‘ ein sehr wertvoller Begriff.»
Wir haben nachgefragt
Alain Bader ist Co-Geschäftsleiter von Sensability und kleinwüchsig. Er plädiert bewusst für die Beibehaltung der Redewendung: «Ich finde diesen Ausdruck nicht negativ – im Gegenteil. Für mich ist ‚auf Augenhöhe‘ ein sehr wertvoller Begriff.» In der Stiftung Rossfeld, in der Bader Stiftungsratsmitglied ist, wurde der Begriff kürzlich sogar intern diskutiert. Bader erinnert sich: «Wir haben vor etwa einem Jahr die Werte der Stiftung neu formuliert – und dabei intensiv über den Begriff ‚auf Augenhöhe‘ gesprochen. Ist das korrekt? Könnte es falsch verstanden werden? Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir ihn beibehalten.»
Für ihn sei die Redewendung nicht nur im übertragenen Sinn kraftvoll, sondern auch ganz konkret spürbar: «Aus dem Alltag weiss ich, wie sich Gespräche verändern, wenn sich jemand wirklich auf dieselbe Höhe begibt – im wörtlichen Sinn. Wenn sich mein Gegenüber hinsetzt, ist der Austausch oft gleich viel persönlicher, ehrlicher.» Auch gehe es beim Begriff nicht nur darum, wer sich wem anpasst. «Es geht um die Haltung dahinter – nicht lediglich um die physische Perspektive», erklärt Bader. Deshalb zeigt sich auch erst im Verhalten der Menschen, ob es in einer konkreten Situation eine Diskussion über Ableismus braucht.
«Es geht um die Haltung dahinter – nicht lediglich um die physische Perspektive.»
Welche Alternativen gibt es?
Baders Ansicht vertreten auch die Inklusionspädagogik und Disability Studies und betonen zunehmend: Wirkliche Augenhöhe ist keine Frage der Körperposition, sondern der Haltung. Es geht nicht um das physische Level, sondern um Wertschätzung, gleichberechtigte Mitsprache und die Anerkennung von Vielfalt. Trotz der positiven Intention lohnt sich ein Blick auf Alternativen zur Redewendung «auf Augenhöhe». Begriffe wie «gleichwertig», «partnerschaftlich», «respektvoll» oder «in gegenseitiger Anerkennung» rücken die Haltung statt die Körperposition in den Fokus. So bleibt die Sprache inklusiv – und die Botschaft von Gleichwürdigkeit klar und zeitgemäss.



